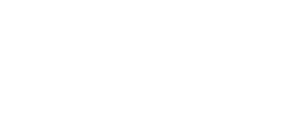Dialog oder Distanz – Wie sollen wir mit „Pegida“ reden?
Deutschlandradio Kultur, 24.01.2015
Über die islamkritische Bewegung Pegida wird zurzeit fast täglich berichtet. Die meisten Anhänger weigern sich mit den Medien zu sprechen. Doch müssen wir nicht mit ihnen ins Gespräch kommen? Oder ist es besser auf Distanz zu bleiben?
Wofür steht Pegida? Wie konnte diese Bewegung binnen kürzester Zeit einen solch großen Zulauf erhalten? Wie können wir uns mit ihren Forderungen, ihren Anhängern auseinandersetzen? Diese Fragen beschäftigen nicht nur die Politik, sie haben auch eine gesellschaftliche Debatte angestoßen. Denn jenseits der Demonstrationen scheint es eine wachsende Gruppe von Menschen zu geben, die sich in unserer Gesellschaft nicht mehr aufgehoben und von der Politik nicht mehr vertreten fühlt.
„Eine Dämonisierung dieser Bewegung führt nicht weiter“, sagt Ulrike Ackermann, Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung und Professorin für Politikwissenschaften an der SRH Hochschule Heidelberg.
„Ebenso wenig die therapeutische Manier, die in der Politik so beliebt ist, die Bürger bei ihren Ängsten abholen zu wollen.“
Zu lange seien wichtige gesellschaftliche Fragen – wie die Einwanderung oder der Umgang mit dem Islam – verdrängt worden. Nun brächen sie sich umso heftiger Bahn.
Pegida-Anhänger seien in der Mehrheit „Feinde der offenen Gesellschaft. Wer läuft denn da mit? Frauenfeinde, Schwulenhasser. Ausländerfeindlichkeit mischt sich mit Putin-Bewunderung und Antiamerikanismus, Deutschtümelei mit der Verachtung der Demokratie und ihrer Institutionen. Das Sammelsurium aus unterschiedlichen Affekten, Parolen und Forderungen mündet letztlich in einem ausgeprägt antiwestlichen Ressentiment – das leider nicht nur den Dresdner Wutbürgern eigen ist.“
Demos als Signal für breite öffentliche Debatte über den Islam
Die Freiheitsforscherin weiß um die Unwägbarkeiten, die eine offene Gesellschaft mit sich bringt:
„Freiheit ist anstrengend. Die Vielfalt der Lebensstile, die wir der Moderne verdanken, ist ja zuweilen auch eine anstrengende Herausforderung.“
Sie sieht die Demonstrationen auch als ein Signal „für eine breit geführte öffentliche Debatte über den Islam – zumal in seiner politischen Gestalt –, über die Einwanderung. Ja, mehr noch über all das, was uns die westlichen Freiheiten wert, wie und von wem sie bedroht sind – und wie wir sie verteidigen müssen.“
„Pegida verschafft der schweigenden Mehrheit ein Ventil“, sagt der Dresdner CDU-Politiker Christian Hartmann. Der 40-Jährige sitzt seit 2009 im Sächsischen Landtag. Er warnt vor Pauschalierungen:
„Die Stigmatisierung ‚Das sind alles Rassisten‘ ist eine falsche Ferndiagnose!“
Argumente der Pegida-Anhänger anhören
Er kennt die Ängste, den Frust und die Wut der Pegida-Anhänger aus seinen Gesprächen im Wahlkreis.
„Es gibt Sorgen und Ängste, sozialer und wirtschaftlicher Art, auch eine Angst vor allem Unbekannten. Versuchen Sie den Menschen aus dem Erzgebirge mal das Phänomen Neukölln zu erklären. Die sagen, ‚Um Gottes Willen, so etwas wollen wir hier nicht!'“
Er plädiert für einen Dialog mit Pegida und nimmt dabei auch die Politik in die Pflicht:
„Man muss erst einmal eine Dialogfähigkeit herstellen, im dem Sinne, dass man aufnimmt, was aus den Demonstrationen und Diskussionen kommt. Was ist dein Argument? Sie zu zwingen, zu sagen, was sie wolle, ihre Forderungen. Wir müssen reden, argumentieren. Wenn Sie das fachlich unterlegen, nehmen Sie schon viel Druck raus. Sie müssen versuchen, die Zusammenhänge zu erklären. Und noch etwas: Die Politik muss signifikant abrüsten. Sie ist Teil des Problems!“
Diese Auseinandersetzung müsse auch – jenseits der medienwirksamen Demonstrationen – weitergehen.
„Wenn das Ziel nur war, die Leute von der Straße zu holen, damit ist das Problem nicht gelöst. Im Gegenteil: Es wird verschärft.“