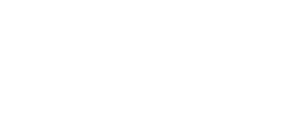Sündenfall der Intellektuellen
Ulrike Ackermann :
Sündenfall der Intellektuellen – Ein deutsch-französischer Streit von 1945 bis heute
Mit einem Vorwort von Francois Bondy
geb. mit Schutzumschlag, zahlr. Abb. EUR (D) 20,00* sFr 34,80, 267 Seiten,
ISBN: 3-608-94278-5, leider vergriffen
Klett-Cotta
Eine Studie über die antitotalitären Traditionen in Deutschland und Frankreich
Ulrike Ackermanns Buch erzählt eine Episode unserer jüngsten Geschichte, die dem kollektiven Gedächtnis zu entgleiten droht. Im 20. Jahrhundert bekämpften sich Faschismus und Nationalsozialismus mit dem Kommunismus auf Leben und Tod. In den Köpfen deutscher und französischer Intellektueller setzte sich dieser Kampf der totalitären Ideologien auch nach dem Untergang von Hitlers Reich fort, mit traumatischen Konsequenzen bis heute. Auf dem 1950 gegründeten „Kongreß für kulturelle Freiheit“, dessen Entstehungs- und Wirkungsgeschichte Ulrike Ackermann anhand der zeitgenössischen Quellen rekonstruiert, fanden sich europäische Intellektuelle zusammen, die sich in der Ablehnung beider Totalitarismen einig waren. Für das Gros der französischen Linksintelligenz jener Zeit stand fest, man müsse die Sowjetunion und ihre „Errungenschaften“ um jeden Preis verteidigen. Erst Ereignisse wie die von Budapest (1956) und Prag (1968) sowie der „Gulag-Schock“ der siebziger Jahre öffneten ihnen die Augen. Französische Intellektuelle begannen einen intensiven Austausch mit den Dissidenzbewegungen Osteuropas und unterstützten sie. Anders die westdeutschen Linksintellektuellen: Ihr „Sündenfall“ bestand darin, nach 1968 auf einen politisch blinden Antifaschismus zu setzen, der sie daran hinderte, sich mit der Realität des kommunistischen Totalitarismus angemessen auseinanderzusetzen. Deshalb konnte von tätiger Solidarität mit den verfolgten osteuropäischen Dissidenten keine Rede sein.
Inhalt
Vorwort von Francois Bondy 9
Einleitung 11
1. „Trügerischer Frieden“: Deutsche und französische Intellektuelle im Streit um den Krieg in Ex-Jugoslawien 19
Pazifistische Gesinnung und Jugoslawien-Nostalgie in Deutschland 28
Pariser Intellektuelle im Kampf gegen ‚Totalitarismus‘ und ‚ethnische Säuberung‘. 42
Deutscher Antifaschismus und französischer Antitotalitarismus:
Der Rekurs auf Auschwitz 48
2. Zurück zu den Anfängen: Antitotalitäre europäische Intelligenz im Kongreß für kulturelle Freiheit 52
Eine kleine kommunistische Vorgeschichte 52
Der Gründungskongreß in Berlin vom 26. bis 30. Juni 1950 57
Antitotalitärer Ost-West-Dialog: Die Zeitschriften Der Monat und Preuves
(Orientierungen und Arbeitsweisen des Kongresses) 77
Die Arbeit des ‚Kongresses‘ zwischen den Kongressen 85
Intellektuelle Brüche: Aufstand in Ungarn 1956 96
Fondation pour une entr’aide intellectuelle européenne:
Ein subversives Netzwerk europäischer Intellektueller 107
Das Ende des Kongresses 109
3. Der Streit um Totalitarismustheorien 102
Antitotalitarismus in Osteuropa 123
Das Jahr 1968 und die Folgen für die französische
Totalitarismustheorie 126
Paradigmenwechsel in Deutschland: Von der Totalitarismustheorie zur Faschismustheorie 132
4. Der Gulag-Schock 1974 144
Solschenizyn in Deutschland – Der störende Renegat 148
Der gefeierte Held – Solschenizyn in Frankreich 154
Front antitotalitaire in Paris 1976 161
5. Die Intellektuellen und der Zusammenbruch des Kommunismus. 173
Der Traum vom Dritten Weg: Antifaschismus und Antikapitalismus der deutschen Intellektuellen 173
Deutsche Ostpolitik: Wandel durch Annäherung 179
Deutsches Unbehagen gegenüber den Dissidenten in Osteuropa 181
‚Solidarität mit Solidarnosc‘ in Paris 190
1989: Geteilte Freude nach dem Sieg der Demokratie und des Kapitalismus 194
6. ‚Weltanschauung‘ von links 201
Kampf um Singularität:
Die Erbschaft des deutschen Historikerstreits 1986 201
Die Instrumentalisierung von Auschwitz 202
Französischer Historikerstreit 1997 208
Schwarzbuch des Kommunismus: Pariser Debatten 208
Der Pawlowsche Reflex im linken Milieu:
Reaktionen in Deutschland 220
‚Feindliche Nähe‘. Der Briefwechsel Furet-Nolte: Ein Kommentar zum französisch-deutschen Streit 232
7. Erinnerung des 20. Jahrhunderts: Intellektuelle zwischen Kontinuität und Bruch 236
Literaturverzeichnis 247
Bildquellennachweis 263
Namenregister 264
Leseproben
Auszug aus dem Vorwort von François Bondy
Das Buch von Ulrike Ackermann ist eines der tätigen Erinnerung, ein Buch gegen das Vergessen.
Es erinnert an ein heute aus dem öffentlichen Gedächtnis weitgehend verbanntes Kapitel deutsch-französischer Geistesgeschichte, deutsch-französischer Intellektuellendebatten in der zweiten Hälfte des abgelaufenen 20. Jahrhunderts.
Diese Debatten – das zeigt nicht zuletzt der Kollaps des kommunistischen Systems in Osteuropa 1989/90 – hatten überaus praktische politische Konsequenzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem die Sowjetunion Stalins als einer der Sieger hervorging, erlebte die kommunistische Bewegung in Frankreich ihren unzweifelhaften Höhepunkt („Résistance“).
Die meisten der tonangebenden französischen Intellektuellen, von Sartre bis Merleau-Ponty, verteidigten die totalitäre Praxis des Kommunismus auch dann, wenn sie sich keiner Täuschung über den Massenterror, die Existenz eines weitverzweigten Lagersystems und das Gespinst von Lügen und Propaganda hingaben – man war gewissermaßen Kommunist wider Willen. Ganz anders in Westdeutschland. Nach der Erfahrung von Faschismus und Nationalsozialismus, aber auch belehrt durch die drückenden Erfahrungen der kommunistischen „Renegaten“ (ein Wort, das ich ungern gebrauche) von Silone bis Koestler bestand unter vielen Intellektuellen Einigkeit darin, daß die Ablehnung und Bekämpfung des Totalitarismus unteilbar sei, daß man genauso entschieden Antikommunist wie Antifaschist sein müsse.
Vor diesem Erfahrungshintergrund wurde 1950 der „Kongreß für kulturellen Freiheit“ ins Leben gerufen, in dessen Auftrag ich die Zeitschrift Preuves herausgab.
Ulrike Ackermann, indem sie die vorhandenen Quellen erschließt und Zeitzeugen befragt, rekonstruiert diese heute fast vergessene Geschichte gegenläufiger Entwicklungen in Frankreich und der Bundesrepublik.[…]
Wenn ich recht sehe, geht es Ulrike Ackermann in ihrem Buch um eine umfassende europäische Perspektive, die auch die Gesellschaften Ostmitteleuropas einschließt. Der Historiker Fritz Stern schrieb fünf Jahre nach dem Ende der kommunistischen Staatsmacht: „Die vielen Menschen in Frankreich und anderswo, die Kontakte zu osteuropäischen Intellektuellen und Künstlern aufrechterhielten, trugen auf eine Weise, die erst noch in vollem Umfang gewürdigt werden muß, zur schließlichen Wiedervereinigung Europas bei.“
Mir scheint, daß Ulrike Ackermann diese Würdigung überzeugend gelungen ist.
Rezension
Mit geschlossenen Augen
Totalitarismus / Ulrike Ackermanns große Studie über deutsch-französische Missverständnisse
Michael Mertes / Rheinischer Merkur (18.08.2000)
Vom Antifaschismus der Nachkriegszeit bis zum Briefwechsel Furet-Nolte: Intellektuelle beider Länder taten sich schwer bei der Beurteilung des Kommunismus.
Vorsicht! Nicht jeder Antifaschist ist ein Anwalt der Menschenrechte – und nicht jeder Antikommunist ein aufrechter Demokrat. Das ist, kurz gesagt, eine der praktischen Schlussfolgerungen aus dem Totalitarismusbegriff. Dieses Konzept, das die Extreme von rechts und links übergreift, dient der Analyse von scheinbar völlig gegensätzlichen Systemen: dem italienischen Faschismus, dem deutschen Nationalsozialismus – und dem Sowjetkommunismus.
Unter den meisten deutschen Intellektuellen ist der Totalitarismusbegriff seit Ende der sechziger Jahre verpönt, während er unter französischen Intellektuellen – nach dem von Alexander Solschenizyn ausgelösten „Gulagschock“ – in den siebziger Jahren glänzende Karriere machte. Dissidenten und Bürgerrechtler jenseits des früheren Eisernen Vorhangs hatten nie ein Problem damit.
Ulrike Ackermann erzählt, wie seit dem Beginn des Ost-West-Konflikts die Wege deutscher und französischer Schriftsteller, Historiker und Philosophen bei der Bewertung des Sowjetkommunismus auseinander liefen. Die heutige Lage verhält sich fast spiegelverkehrt zum Meinungsklima in den fünfziger Jahren. Damals war die französische Intelligenz mehrheitlich „positiv vom Totalitarismus kommunistischer Prägung fasziniert“; in Deutschland jedoch bestimmte das Klima „ein antitotalitärer Konsens, der zuweilen stark antikommunistisch eingefärbt war“.
Ackermanns Buch spannt den Bogen vom Berliner „Kongress für kulturelle Freiheit“ im Juni 1950 bis zum Briefwechsel zwischen François Furet und Ernst Nolte in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre.
Die von Melvin J. Lasky, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Manès Sperber und anderen gegründete Internationale des Antitotalitarismus entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem subversiven Netzwerk, das bis zum Fall der Mauer den hoch infektiösen Bazillus unabhängigen Denkens in Ostmitteleuropa verbreiten half. Bemerkenswert ist die auf deutscher Seite klaffende personelle Lücke – von löblichen Ausnahmen wie Heinrich Böll einmal abgesehen.1966 enthüllte die „New York Times“, dass der „Kongress für kulturelle Freiheit“ zu großen Teilen von der CIA finanziert worden war. Damit brach diese Veranstaltungsreihe – nicht aber das aus ihr hervorgegangene Netzwerk von Freundschaften und solidarischen Kontakten – zusammen. Es gab einen großen Sturm der Entrüstung. Doch im Rückblick wird man die CIA dazu beglückwünschen dürfen, dass sie ihr Geld (ausnahmsweise?) gut angelegt hatte.
Für Ackermann drückt sich im anhaltenden Widerstand deutscher Intellektueller gegen den Totalitarismusbegriff nicht nur die Neigung aus, „die Deutschen nach 1989 als Tätervolk zu rehabilitieren“. Sie führt diese Einstellung vor allem auf das „traditionsreiche linke Postulat zurück, wonach der Faschismus die höchste Form des Kapitalismus sei“.
Der französische Historiker Furet war so souverän, im Werk seines deutschen Kollegen Nolte die nationalapologetische Spreu vom antitotalitären Weizen zu trennen – hierzulande würde zu einem solchen Unterfangen viel Mut gehören. Allzu leicht lässt sich in der Bundesrepublik intellektuelle Feigheit immer noch mit Angst vor „Beifall von der falschen Seite“ bemänteln.
Bemerkenswerten Nonkonformismus legte deshalb der von Ackermann zitierte Nolte-Kritiker Heinrich August an den Tag, als er 1998 Winkler schrieb, der Sinn des argumentativen Verweises auf Auschwitz liege „offenbar darin, dass die Deutschen auserwählt wurden, das absolut Böse zu tun, und darum berechtigt, ja verpflichtet sind, ihren Negativrekord gegenüber unerwünschter Konkurrenz zu behaupten“.
Ulrike Ackermanns Buch ist eine der wichtigsten und originellsten Neuerscheinungen dieses Jahres über die Zeit des Kalten Krieges – hervorragend dokumentiert und ein überzeugendes Beispiel dafür, wie dramatisch und spannend Ideengeschichte sein kann. Ausgiebig lässt Ackermann die Akteure selbst zu Wort kommen. So bleibt den Lesern in jedem Augenblick bewusst, dass es der Autorin nicht nur um Höhenflüge in das Reich abstrakter Gedanken geht, sondern auch und vor allem um Verdienst und Versagen konkreter Menschen.
Ideengeschichte präsentiert sich hier als großes Epos über den Widerstreit von Blindheit und Klarsicht, Feigheit und Mut. Nicht zuletzt Mut zur Korrektur eigener Irrtümer. Den finden wir etwa bei Jorge Semprún, der als spanischer Kommunist KZ-Häftling in Buchenwald gewesen war. Der Gulag-Schock nahm ihm die „Unschuld des Gedächtnisses“; es wurde Semprún unmöglich, sich weiterhin „in dem heiligen Öl des latenten guten Gewissens“ zu baden. Er rang sich zu der Einsicht durch, „dass ich meine Erfahrungen in Buchenwald, Stunde um Stunde, mit der verzweifelten Gewissheit, dass es gleichzeitig russische Straflager … gab, wiederaufleben lassen müsste“.
Ulrike Ackermann gehört zu jenem relativ kleinen Kreis deutscher Intellektueller, die gegen alle Anfeindungen am Totalitarismusbegriff festgehalten haben und auch nie der Versuchung erlegen sind, die Freiheitsbewegungen im sowjetisch dominierten Teil Europas als destabilisierend, gar als Gefahr für den Frieden zu beargwöhnen. Wir wissen heute, dass sich die kleinen und großen Metterniche des Kalten Krieges, die westeuropäischen und nordamerikanischen Anwälte der scheinbar unumstößlichen „Ordnung von Jalta“, gründlich geirrt haben. Genugtuung darüber ist der Autorin durchaus anzumerken, aber ein rechthaberischer Triumphalismus ist ihr fremd.
In der Tat: Bis auf den heutigen Tag verkennen viele Politiker und Publizisten den wahren Charakter blutiger Konflikte, weil sie Gefangene alter Denkmuster geblieben sind.
Ackermann erläutert das am Beispiel Jugoslawien: Es zählt mittlerweile zu den als unumstößlich geltenden Wahrheiten, dass sich während der neunziger Jahre auf dem Balkan ein „uralter Völkerhass“ ausgetobt, dass dort ein „Kampf der Kulturen“ oder gar ein „Religionskrieg“ stattgefunden habe. Tatsächlich verantwortlich für das Blutvergießen waren indes jene (post-)kommunistischen Diktatoren, die den angeblich „uralten Völkerhass“ zur Festigung ihrer eigenen Macht heraufbeschworen und dann instrumentalisierten. Erst die Etikettierung von Slobadan Milosevic als „Faschist“ verschaffte ehemaligen Pazifisten wie Joschka Fischer die Legitimation, einer deutschen Teilnahme am Kosovo-Krieg zuzustimmen.
Die Tabuisierung des Totalitarismusbegriffs erschwert bis heute auch eine gründliche Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur. Als Hüterin des „Antifaschismus“ immunisierte sich die PDS gegen Kritik, während sie gleichzeitig ein Instrument zur historisch-moralischen Diskreditierung politischer Gegner in der Hand behält. Hinter diesem Schutzschild pflegt sie die antiwestliche Nostalgie nach dem autoritären Staat, die sie mit der extremen Rechten teilt. Die auffällige Überschneidung der Wählerpotenziale von PDS einerseits und Parteien wie DVU oder NPD andererseits deutet darauf hin, dass die Wege vom sozialistischen zum völkischen Kollektivismus und wieder zurück wesentlich kürzer sind, als der „Antifaschismus“ uns glauben machen will.
Es ist Zeit für eine Erneuerung des antitotalitären Grundkonsenses aus den Anfängen der Bundesrepublik. Wer das nicht glauben mag, dem wird Ulrike Ackermanns Buch zur Einsicht in die Notwendigkeit verhelfen.“
Rezension
Auf dem einen Auge blind
Ulrike Ackermann beschreibt den „Sündenfall der Intellektuellen“
Von Marko Martin (Die Welt, 29.07.2000)
Eigentlich weiß man es ja: Stalins Verbrechen, Chruschtschows Geheimrede, die Ereignisse von Budapest und Prag, die Abwendung französischer Intellektueller vom Kommunismus, GULag-Schock und „Neue Philosophen“. Und in Deutschland das Aufkündigen eines antitotalitären Konsens im Zuge von ’68, die Instrumentalisierung von Auschwitz als Argument gegen die Wiedervereinigung, das Schweigen zu Bosnien.
Fetzen irrlichtern durch die Debatten und Feuilletonbeiträge, doch bleibt der konkrete ideengeschichtliche Hintergrund dieser deutschen und französischen Intellektuellendebatten zumeist ausgespart. Nun hat die Frankfurter Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Ackermann ein Buch vorgelegt, das eben jene „Rekonstruktion von Ideologiebildungen“ wagt und sich auf eine „Spurensuche nach den kollektiven Abwehrmechanismen gegenüber offenem, unabhängigem, dissidentem Denken“ begibt.
Ein gelungener Versuch, denn die Studie ist gleich in mehrfacher Hinsicht interessant: Als Diskussionsbeitrag über die fortdauernde Aktualität der Totalitarismustheorie, als Aufzeichnung intellektueller Delirien im 20. Jahrhundert, als Zeitspiegel zu den jüngsten Ereignissen – siehe Sarajevo, siehe Kosovo – und nicht zuletzt als detailliertes Handbuch, das endlich auch die Biografien derer erzählt, die bislang lediglich als Stichwortgeber wahrgenommen wurden.
Herrschte diesseits des Rheins in den fünfziger Jahren ein antitotalitärer Konsens, so waren die maßgeblichen französischen Intellektuellen – mit den einsamen Ausnahmen von Raymond Aron und Albert Camus – ideologisch eng mit der Kommunistischen Partei liiert. Der russische Einmarsch in Budapest, spätestens aber die Invasion in Prag, provozierte dann den Bruch mit der Partei – eine Entwicklung, die durch die libertär-radikalen, oft sogar antikommunistischen Tendenzen des Pariser Mai 1968 noch verstärkt wurde.
In Deutschland besann man sich mit wachsendem Abstand zum Dritten Reich stattdessen eines „Antifaschismus“, der die Erwähnung des Nationalsozialismus fast schamhaft vermied und den Holocaust hauptsächlich in dem Sinne thematisierte, als sich die Nazi-Greuel als Endkonsequenz des Kapitalismus darstellen ließen.
Man erfährt Ausführliches über die europaweite Arbeit des „Kongresses für kulturelle Freiheit“ in den fünfziger Jahren, über Melvin Laskys „Monat“ und François Bondys „Preuves“ und findet noch einmal schwarz auf weiß dokumentiert, dass die Pioniere der Antitotalitarismustheorie mitnichten verschwiemelte rechte Relativierer waren, sondern linksdemokratische Intellektuelle, die mit Mühe und Not beide Terrorsysteme überlebt hatten. Margarete Buber-Neumann, im GULag und im KZ Ravensbrück interniert; David Rousset, ein Résistancekämpfer und Buchenwald-Überlebender, der sich bereits 1949 für die Deportierten in den sowjetischen Lagern einsetzte; Alexander Weißberg-Cybulski, 1937 in der Sowjetunion verhaftet, 1940 an Deutschland ausgeliefert, danach am Warschauer Ghetto-Aufstand beteiligt.
Was ist der Grund für diese Amnesie, wie konnte es geschehen, dass zu Gunsten abstrakter Faschismus-Kritik die verbrecherische Realität des Kommunismus bis heute kaum zur Kenntnis genommen wird? Ulrike Ackermann erklärt es mit dem abrupten Abbruch einer Tradition. In Frankreich dagegen ein fortgesetztes Gespräch zwischen dem liberalen Raymond Aron, dem ex-maoistischen André Glucksmann, zwischen Daniel Cohn-Bendit und dem Historiker François Furet. Schade, dass es – aus falscher Scheu? – nicht deutlicher erwähnt wird: Die meisten dieser antitotalitären Intellektuellen sind Juden, alte Résistance-Kombattanten wie der inzwischen aber neunzigjährige Historiker François Fejtö oder Söhne Ermordeter wie André Glucksmann. Sie wissen, dass Auschwitz selbstverständlich singulär war und dass gerade aus diesem Grund der genaue Blick auf Vergleichbares gerichtet werden muss. In Deutschland dagegen die germanischen Scheingefechte zwischen linken und rechten Relativierern, Gremliza und Wippermann versus Nolte und Mahler. Eine deprimierende Perspektive.
Marko Martin ist Autor eines Buchs über den „Monat“ sowie Herausgeber eines Auswahlbandes von 70 „Monat“-Essays aus vier Jahrzehnten. (Beitz Athenäum Verlag, 2000. 591 S., 98 Mark).
Rezensionen aus „Perlentaucher.de“
Neue Zürcher Zeitung vom 07.03.2001
„Ein Ärgernis“ nennt Jürgen Ritte dieses Buch, das die Totalitarismusdebatte in Deutschland und Frankreich untersucht und dabei von verschiedenartigen politischen Blindheiten beider Seiten ausgeht. Auch wenn er bei einem solch umfangreichen Thema die Notwendigkeit von „Verknappungen und Zuspitzungen“ durchaus eingesteht, ist er empört über etliche inhaltliche Fehler – der Goethepreis ist nicht der Friedenspreis des deutschen Buchhandels – und bezichtigt die Autorin implizit sogar der üblen Nachrede Thomas Manns. Ackermann „fälsche Zitate“, habe eine „abenteuerliche Argumentation“ und sei obendrein nicht zur korrekten Anwendung der Grammatik fähig. In der deutsch-französischen Betrachtung weist Ritte ihr Tatsachenfälschung nach, wohl damit sie ihren Argumentationsstrang beibehalten kann. Hinter diesen „Unschärfen“ macht der Rezensent eine Strategie aus, nach der das Buch „funktioniere“. Abschließend wird bemerkt, dass die angestrebte Studie über den Sündenfall zum Fallbeispiel eines solchen geworden ist.
Süddeutsche Zeitung vom 20.01.2001
Sylvia Schütz befasst sich eingehend mit der Untersuchung, die die unterschiedlichen politischen Ansichten von Intellektuellen in Deutschland und Frankreich beleuchtet, wobei sie den Hauptschwerpunkt des Textes in der Auseinandersetzung der Intellektuellen mit dem Faschismus und dem Kommunismus sieht. Die Rezensentin ermittelt als maßgebliches Quellenmaterial für die Studie die Diskussion von Ereignissen in Osteuropa in den wichtigsten „linksliberalen deutschen und französischen Zeitungen und Zeitschriften“. Die Autorin – Politikwissenschaftlerin und Publizistin – mache deutlich, woraus die unterschiedliche Einstellung vor allem zum Kommunismus resultiert. Die Studie ist ein „Plädoyer für kritische Selbstreflexion und für die bewusste Wahrnehmung interkultureller Differenzen“, meint die Rezensentin, die den Ergebnissen der Autorin insgesamt zuzustimmen scheint, ohne dies explizit auszusprechen.
Frankfurter Rundschau vom 06.12.2000 Literaturbeilage
Was Martina Meister von Ulrike Ackermanns „Sündenfall der Intellektuellen“ hält, macht sie schon im ersten Satz ihrer Besprechung deutlich. Für sie ist es eine oberflächliche, einseitige Abrechnung mit den linken Intellektuellen der Bundesrepublik im zweigeteilten Deutschland. Auch wenn Meister der Rezensentin darin zustimmt, dass die Linke den Terror der kommunistischen Staaten oft nicht wahrnehmen wollte, und eine Auseinandersetzung mit dieser Blindheit für so wünschenswert hält wie die Autorin, empfindet sie Ackermanns Darstellung dennoch als unseriös. Meister zeigt auf, wie die Autorin die Entwicklung der französischen Intellektuellen als eine Art spiegelverkehrt verlaufende ausweist, um so ihr Urteil über die Intellektuellen der Bundesrepublik noch stärker zu akzentuieren. Die französischen Linksintellektuellen hätten nämlich spätestens mit der Veröffentlichung des „Archipel Gulag“ dem Kommunismus abgeschworen. Meister gibt ihr Recht, bemängelt jedoch, dass Ackermann vor allem bei der Auseinandersetzung mit den Totalitarismus-Diskussionen in Deutschland die Prämissen ihrer These nicht darlegt.
Die Zeit vom 16.11.2000 Literaturbeilage
Eher gelangweilt als empört schreibt Rudolf Walther einen ordentlichen Veriss über Ulrike Ackermanns Buch, in dessen Mittelpunkt für ihn die „Kontinuität des Antitotalitarismus zwischen 1950 und 2000 und die Reaktionsmuster deutscher und französischer Intellektueller auf die `totalitäre Versuchung` (Ackermann) stehen. Ausgangspunkt für die Kontinuitätsthese ist der „Kongress für kulturelle Freiheit“ von 1950, auf dem sich die Antikommunisten unter den Schriftstellern zusammenfanden. Die Geschichte ihrer Publikationsorgane wird von Ackermann höchst unvollständig recherchiert, so Walther, lieber schießt sie mit einem völlig ungeklärten Totalitarismusbegriff gegen das „linksliberale Milieu“. Das Buch ist für den Rezensenten eine „Synthese aus der Festplatte.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30.08.2000
Fast uneingeschränktes Lob hat Jürg Altwegg für dieses Buch. Lediglich den Titel findet er „abgenutzt“ und vor allem „missverständlich“. Den Ackermann erzähle nicht von den „unverbesserlichen Altlinken“, die den Kommunismus heute noch verteidigen, sondern von den Intellektuellen, die den Stalinismus frühzeitig kritisiert haben. „Kernstück“ des Buchs sei die Geschichte des Kongresses für die Freiheit der Kultur, den Melvin J. Lasky 1950 gründete. „Akribisch“ beschreibe Ackermann die Beiträge, die „Renegaten“ wie Koestler, Silone, Aron oder Camus leisteten. Es ist eine „verdiente , willkommene, notwendige Rehabilitierung jener, die gegen die ideologische Blindheit immun waren und gar nie an eine Paradies glaubten“, lobt der Rezensent.